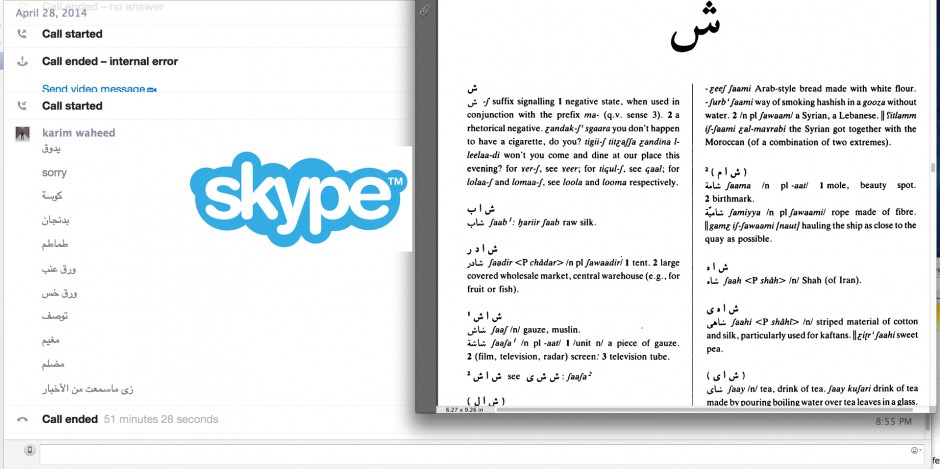«Erzählen Sie mal, warum kommen Sie heute zu mir? Was tut Ihnen weh?» Die Anamnese ist das A und O in der Medizin. Man muss schliesslich wissen, was der Patient hat, um ihn behandeln zu können. Eine gute Anamnese erfordert aufmerksames Zuhören und die Fähigkeit, auch zwischen den Zeilen lesen zu können. Wie wichtig die Sprache in der Medizin ist, habe ich hier in Bordeaux in meinem Erasmus-Jahr zu spüren bekommen:
Vor einigen Wochen wurde ich Zeugin einer bizarren Kommunikation zwischen ‚Arzt‘ und Patient: Ein Gespräch im Spital zwischen einer Thailänderin, die kaum Französisch sprach, und einer italienischen Erasmusstudentin, die ebenso wenig Französisch konnte. Es ging darum, dass die Patientin einen Fragebogen zu ihren vegetativen Funktionen – also alles, was ihr Körper ohne Nachdenken ausführt – ausfüllen sollte. Nur konnte sie nicht lesen.
Also versuchte die norditalienische Studentin, die Fragen auf Französisch vorzulesen. Stell dir also eine Italienerin mit perfektem dunklen Kajal-Strich vor, die laut und deutlich artikuliert und ihre Hände benutzt, um Akzente zu setzen. Ihr gegenüber eine feine Person in einer rosaroten Strickjacke, mehr flüsternd als sprechend. «Hatten sie im vergangenen Monat Verstopfungen?» Eine undeutliches Zischen war die Antwort. «COSÀ?» Eine tanzende Hand.
Die Italienerin wuchs mit ihrer immer intensiver werdenden Stimme, die Patientin hingegen schrumpfte ein wenig in sich zusammen. «Sie wissen nicht, was Verstopfung bedeutet?» Ein Nicken. Mit grossräumigen Gesten und passender Mimik gab die Studentin alles, um es der Patientin ohne Wörter zu beschreiben. Es schien zu funktionieren: Ein ‚Ah‘ und ein weiteres Nicken waren das Resultat. Weiter zur nächsten Frage, es blieben nur noch zwanzig. Die Situation erinnerte stark an ‚Time’s Up‘ mit Themen wie Blasenentleerungsstörung, schwankendem Blutdruck, vaginaler Trockenheit und Orgasmusproblemen.
«Hören Sie mich?»
Doch was tun, wenn der Patient gar keine Antwort geben kann? Ich stehe vor einem weissen Krankenbett. Die Laken sind am Fussende aufgetürmt, die Patientin glüht vor Hitze. Ein leises Röcheln entweicht ihr bei jeder Ausatmung, ihr linker Arm zittert mit einer tiefen Frequenz, als würde sie langsam, die nach Familienrezept zubereitete Kartoffel-Crèmesuppe noch ein letztes Mal langsam umrühren, bevor sie das Gericht zufrieden auf einen liebevoll gedeckten Tisch abstellt.
Auf meine Berührung hin und als Reaktion auf meine Stimme öffnet sie ein wenig ihre Augen und schaut mir ins Gesicht. Ob sie mich wirklich sieht, weiss ich nicht. «Madame, können Sie mich hören?» Stille. «Tut Ihnen etwas weh?» Stille, die Suppe wird nochmals umgerührt. «Ich werde Ihr Herz abhören, nicht erschrecken.» Keine Reaktion. Die Herzfrequenz ist erhöht, ihre Lungen rasseln. Hat Sie Schmerzen? Wie kann ich ihr nur helfen? Ich stehe nur da, schaue ihr ins Gesicht, bin verloren. Fragen stelle ich keine mehr, denn ich verstehe die Antworten nicht.
«Was wird nur aus mir?»
Es gehört aber noch vieles Mehr zur Kommunikation als ausgesprochene Wörter. Man muss den Körper beobachten, die Mimik, in Sprechpausen möglicherweise Unausgesprochenes erahnen. Unausgesprochenes, weil es beschämend sein kann über Stuhlgang, Impotenz oder Geldprobleme zu reden.
So hilft es auch nichts, dass bei der Visite sowohl der Professor sowie die Patientin perfekt französisch sprechen können. Der Professor stellt einige Fragen, die Patientin antwortet. Aber schon nach der letzten medizinischen Information, die ihren Mund verlässt, hört er ihr nur noch mit halbem Ohr zu. Das bemerkt auch die Patientin. Ihre Reaktion: Sie hört nicht mehr auf zu sprechen. Der Professor schenkt ihr gezwungenermassen wieder seine Aufmerksamkeit. Sie hört trotzdem nicht auf, laut ihre ratternden Gedanken kund zu tun, sie ist ein wenig verärgert.
Mit «Madame, ich habe Sie vernommen», möchte der Professor sie beschwichtigen, aber sie hört noch immer nicht auf. Redet von ihrer Zukunft, dass sie nicht weiss, was sie machen soll, was aus ihr werden soll. Der Professor versucht ihr eine Möglichkeit zu erklären, aber jetzt scheint sie ihm hingegen nicht mehr zu zuhören. Sie reden total aneinander vorbei. Nach zwei Minuten ist der Professor so irritiert, dass er kurzerhand aufsteht, verkündet: «Machen Sie doch, was Sie wollen», und das Zimmer verlässt. Totenstille macht sich breit. Medizinstudierende starren einander an, starren die Patientin an, jene starrt zurück. Niemand kann verstehen, was gerade passiert ist. Wie ging das noch einmal: Der Esel bleibt stehen?
Kommunikation ist vielseitig
Im Spital muss man einfach versuchen, einen Weg zu finden, alle wichtigen Informationen von den Patienten zu bekommen, um eine gute Behandlung garantieren zu können. Sei das mit Hilfe eines Übersetzers, körperlichen Anzeichen oder schlicht und einfach viel Geduld.
Dabei müssen beim Gespräch alle Ebenen der Sprache abgedeckt werden. Man kann nicht nur beobachten, um zu behandeln. Ebenso wenig kann man nur die inhaltlichen Fakten als wichtig einstufen, ohne den dabei gequälten Ausdruck zu interpretieren. Es geht ums grosse Ganze. Sowohl der Patient als auch der Arzt müssen sich wohlfühlen, erzählen und zuhören wollen.
Kommunikation ist eine Kunst, die geübt und hinterfragt werden muss. Ein lebenslanges Studium. Also los; Kommuniziert! Übt euch in Pantomime und geniesst es kommunizieren zu können. Denn wie Paul Watzlawick so schön sagt: «Man kann nicht nicht kommunizieren!» Aber es braucht auch jemanden, der zuhört.