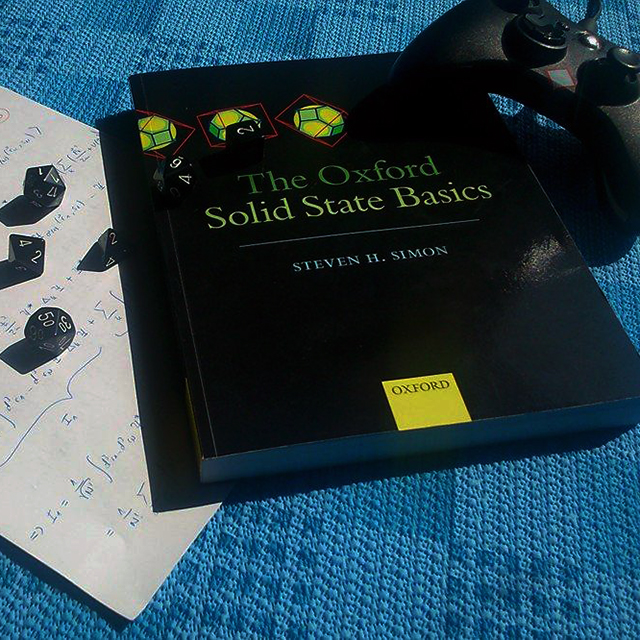Wir alle kennen sie, die typischen Klischees über die Schweiz: Käse, Banken, Schoggi, Neutralität und Pünktlichkeit. Das sind übertriebene Stereotypen, dachte ich immer, bis ich ihnen plötzlich selber verfiel – während eines Erasmus-Semesters in München.
Wie viele gehe auch ich seit der Corona-Zeit regelmässig spazieren. Im mir nahe gelegenen Nymphenburger Schlosspark schlendere ich gedankenverloren über Wiesen, flaniere an Kanälen entlang und an Burgen vorbei, beobachte Vögel und lasse meinen Blick über endlos scheinende Wälder schweifen. Klingt kitschig? Ist es auch.
Der Nymphenburger Schlosspark ist inszenierte Natürlichkeit par excellence. Zunächst als französischer Barockgarten angelegt und formal streng durch geometrische Formen und Achsen gegliedert, wurde er zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach dem Geschmack der Zeit umgestaltet. Aus Regelmässigkeit und Ordnung wurden weitläufige Blicke, aus linearen Wegen ein schwungvolles Netz und aus Kanälen natürlich erscheinende Bäche und Seen. Während der warmen Jahreszeit zogen sich die Kurfürstinnen und Kurfürstem in ihre Sommerresidenz ausserhalb der Stadt zurück, wo sie sich ausgiebig dem Lustwandeln hingaben. Meine Erfahrung diese Tage ist durchaus profaner, wenn ich mit Stöpsel in den Ohren an Entenfamilien und Ornithologen vorbeilaufe.
Ein Reh aus dem Jenseits
Kürzlich jedoch hatte ich ein irritierendes Erlebnis. Ich spazierte gemütlich in abendlicher Dämmerung einem See im Nymphenburger Schlosspark entlang, als mir plötzlich ein junges Reh den Weg abschnitt, sich ins Unterholz zurückzog, ruckartig stehen blieb und mich aufgeschrocken anstarrte.
Ich blieb zunächst verwirrt stehen, rieb mir die Augen und blickte desorientiert umher – nur um sicherzugehen, dass ich mich noch in München befand, und nicht versehentlich in Bambi verlaufen hatte. Die Szenerie fühlte sich surreal und kitschig, wenn nicht gar inszeniert an.
Vor meinem inneren Auge stellte ich mir vor, wie der Auftraggeber für die Umgestaltung des Gartens, Kurfürst Max IV. Joseph, aus dem Jenseits seinen Park beobachtet, und hin und wieder ein Reh vorbeischickt, um der romantischen Stimmung gewissermassen ein Sahnehäubchen aufzusetzen. Als hielte er die Fäden eines Puppenspiels in der Hand, um mir die Perfektion seiner fingierten Natürlichkeit vor Augen zu führen. Genau so, dachte ich, musste sich Truman Burbank fühlen, als er seine Umgebung als Kulisse entlarvte und erstmals hinter den Schein seiner Existenz blickte.
Das perfekte Schweizer Puppenspiel
Es ist befremdlich, wenn man der greifbaren Umwelt plötzlich nicht mehr traut, weil sie sich wie eine Szene aus einem Drehbuch präsentiert. Ein ähnliches Gefühl überkommt mich, wenn ich mit nationalen Klischees konfrontiert werde. Plötzlich ist man von so vielen Stereotypen umgeben, dass man gar nicht mehr erkennen kann, was Wirklichkeit ist.
Offenbare ich im Ausland, dass ich Schweizerin bin, denken viele, ich wohne in einer Holzhütte mit Ausblick auf die Alpen und ernähre mich hauptsächlich von Käse und Schoggi. Nach dem Aufstehen melke ich erstmals die Kühe, jodle mit Heidi ins Tal hinunter, suhle mich in meiner Neutralität und lege abends meine Goldbarren unters Kopfkissen. Das mag überspitzt klingen, aber ich wurde tatsächlich schon gefragt, ob wir in der Schweiz eigentlich mit Ski zur Schule fahren – no shit.
Einmal hat mir jemand erzählt, dass er sich die Schweiz immer wie eine Art Schlaraffenland vorstelle – ein Ort, von dem man sich sehnlichst erhofft, dass es ihn gibt, auch wenn man insgeheim weiss, dass er so nicht existieren kann.
Für mich fühlt sich die Konfrontation mit diesem schrägen Bild der Schweiz an, als zeichne mein Gegenüber mir Eigenschaften auf die Haut, die wenig mit der Realität und schon gar nichts mit mir zu tun haben.
Ricola und Betty
Meistens belächeln wir solche Klischees. Wir entlarven sie als rückständig und erheben uns über sie. Ist ja auch irgendwie süss, dieses Bild der Schweiz, das direkt einem Bauernroman entstammen könnte…
Doch manchmal, ja manchmal, da scheint man ihnen auch irgendwie zu verfallen. Mir jedenfalls passiert das immer, wenn ich längere Zeit im Ausland lebe. Das beginnt meist ganz harmlos: Ich kaue keine Kaugummis mehr, ich nasche plötzlich Ricola. Am 6. Januar backe ich dann Dreikönigskuchen, um meinen Mitmenschen ein bisschen Schweizer Tradition im Gaumen zergehen zu lassen. Zu Ostern folgt dann gleich die nächste Backaktion: Schweizer Osterchüechli, ein Rosinen-Reisgebäck, das ich zuhause zu keiner Jahreszeit essen würde. Das Rezept von Betty Bossi, versteht sich. Auf einmal höre ich vermehrt Patent Ochsner und summe in der Dusche d’W. Nuss vo Bümpliz vor mich hin. Wenn ich unpünktlich zu einem Treffen erscheine, schiebe ich das auf meine italienischen Gene, als könnte man nicht gleichzeitig Schweizerin und meistens zu spät sein.
Ich habe mich schon oft gefragt, woran das liegen mag, diese plötzliche Rückbesinnung auf Dinge, die einem Zuhause ziemlich egal waren. Vielleicht ist das meine Art, mich an einem fremden Ort einzurichten.Das ist, wie wenn man Fotos an weisse Wände klebt, um sich einen Raum zu eigen zu machen. Und als würde ich mir durch die vielen klischierten Handlungen einen eigenen Garten zusammenstellen – einen, in dem man an lauen Sommernächten ewig sitzen bleiben möchte.
Belanglos und bitter
Bei mir folgt auf dieses wohlige Gefühl von Vertrautheit meist ein bitterer Nachgeschmack. Er begleitet jede dieser harmlosen Handlungen… Mir wird unwohl, wenn ich bemerke, wie ich mich auf vermeintliche Exportschlager meiner Heimat besinne. Denn wie die inszenierte Landschaft eines Parks, konstruieren auch nationale Klischees ein einheitliches Bild von etwas, was längst, wenn überhaupt, der Vergangenheit angehört. Mit verklärtem Blick wird ein idyllisch anmutendes Ensemble zusammengestellt, eine sich aus der Ferne erträumte Fiktion: der homogene Garten der Nation. Hier die unberührte Natur, dort die Essenz einer Nation. Beides genuine Produkte der Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts, und wir alle wissen ja, wohin die uns geführt hat…
Natürlich ist «Ricola kauend einen Dreikönigskuchen backen» nicht gleich «sich nostalgisch auf den Volksgeist besinnen». Meine Aktionen sind banal, belanglos, und kümmern höchstens die Endverbraucher meiner Backkunst. Trotzdem kann ich mich ihnen nie so wirklich bedenkenlos hingeben, und das ist vermutlich gut so. Vielleicht ist das die Erinnerung an unsere Geschichte, die in unseren Köpfen steckt, und sich so einfach nicht abstreifen lässt.
Nachdenken, danach: weiterlaufen…
Vom Puppenspiel des Kurfürsten Max IV. Joseph, oder Seppli der Vierte, wie ich ihn nenne, habe ich mir jedenfalls nichts vorgaukeln lassen. Stattdessen habe ich mich geduckt, den Boden unter meinen Füssen berührt und mich versichert, dass ich mich noch in dieser Welt befinde. Vielleicht muss man genauso mit nationalen Klischees umgehen, sie anhören, hinterfragen, als Konstrukte entlarven und dann vom eigenen Körper schütteln.
Von Sepplis Schauspiel unbeeindruckt habe ich schliesslich die Musik etwas lauter gedreht, einem Ornithologen nett zugelächelt und bin, mir nichts dir nichts, in Richtung Abendrot weiter lustgewandelt.