Heute wird gestreikt. Für ganz unterschiedliche Anliegen werden Frauen* in der Schweiz ihre Arbeit niederlegen und durch die Strassen ziehen. Ich habe mir das Ereignis zum Anlass genommen, um über Frauen an der Universität, über Vorbilder, Tradition und Repräsentation nachzudenken.
Sie hätte das Seminar extra gewählt, meinte eine Kommilitonin kürzlich zu mir, weil im Kursbeschrieb explizit erwähnt wurde, dass «Gemälde durch die Brille der Philosoph/innen» betrachtet würden. Geil, endlich nicht nur Hegel und Heidegger, dachte sie sich, endlich ein Professor, der versucht, weibliche Positionen in die Lehre zu integrieren.
Leider wurde sie enttäuscht. Zum Semesterbeginn, den Seminarplan in den Händen haltend, hat sie den Professor auf das nicht eingelöste Versprechen hingewiesen. Dieser hat ihr versichert, dass er sich dieser Lücke bewusst sei, er hätte sich bemüht und dennoch keine dem Seminarthema angemessenen Texte von Frauen* gefunden. Es soll hier gar nicht angezweifelt werden, dass es eine Herausforderung darstellt, Persistenzen zu durchbrechen und dennoch scheint es mir an der Zeit, auf Versprechen Handlungen folgen zu lassen.
Im Anschluss an die letzte Sitzung meinte sie zu mir: «Es ist einfach deprimierend…sag mir, wieso genau soll ich mich jetzt gleich wieder an meine Masterarbeit setzen, wenn wissenschaftliche Texte von Frauen* doch kaum rezipiert werden.»
Kanon und Koloss
Der Kanon vieler Disziplinen ist weiss, männlich und scheint auch heute noch wie ein verwurzelter Koloss stolz und aufrecht in der akademischen Landschaft zu stehen. Ein solcher findet sich auch im Herzen der Universität Basel, beim Kollegiengebäude. Stramm steht sie da, die monumentale Skulptur Lehrer und Schüler von Alexander Zschokke.
An der Schwelle zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit stehen die zwei massiven, aus Kalkstein gehauenen und miteinander verbundenen Körper. Der ältere scheint dem Nachwuchs das Erbe weiterzureichen. Den Vorübergehenden kommuniziert das Werk bereits vor dem Eintritt ins Gebäude, welche Kriterien die hierarchischen Strukturen hinter den Mauern beeinflussen. Und ohne grossen Lärm vergisst die Skulptur einen Teil ihrer Realität zu repräsentieren. Sie verschleiert, dass es 1944, zur Zeit ihrer Entstehung, bereits Studentinnen an der Universität Basel gab, wenn auch nicht zahlreiche.
Basel hinkte hinterher
Die Schweiz ist bekannt für ihre Rückständigkeit bezüglich des Frauenstimmrechts. Es überrascht umso mehr, dass dasselbe Land in punkto Zugang zu universitärer Bildung für Frauen im europäischen Vergleich an der Spitze mitmischte. Während jedoch in Zürich, Bern, Genf, Lausanne und Neuenburg Frauen bereits um 1865 studieren durften, liess sich die Universität Basel Zeit. Ab 1890 wurden «versuchsweise» Frauen zum Studium zugelassen und erst 1937 wurde im Basler Universitätsgesetz die Gleichstellung von Studenten und Studentinnen, Ausländern und Ausländerinnen verankert.
Der Basler Bildhauer Alexander Zschokke war eng befreundet mit seinem Malerkollegen Niklaus Stoecklin, der ebenfalls seine Spuren im Kollegiengebäude hinterlassen hat. Im ersten Obergeschoss zwischen den Hörsälen reihen sich die einzelnen Gemälde des Bildzyklus Die Fakultäten aus den Jahren 1930/31 ein. Auf blauem Hintergrund stellt Stoecklin vierzehn stereotypisierte Figuren unterschiedlicher akademischer Berufsfelder dar.
Karikaturistisch verzerrt scheinen die Figuren komplett von ihrer Umwelt abgeschottet und in ihre Arbeit versunken. Anders verhält es sich bei der einzigen Frau im Zyklus, der Apothekerin. Stoecklin malt sie mit grossen Augen, einer schmalen Taille und einem tiefen Ausschnitt. Einen Fiebermesser zwischen die vollen Lippen geklemmt, ist sie dargestellt, wie sie sich über einen Tresen gelehnt dem Betrachter präsentiert. Abgesehen davon macht diese Apothekerin rein gar nichts. Anders als ihre Kollegen untersucht sie keine Steine, entziffert keine Hieroglyphen, blickt nicht durch ein Teleskop und ich frage mich: «Müssen Frauen* sich lasziv über einen Tresen beugen, um repräsentiert zu werden?»
«Der Druck des Stummseins»
Bis heute gehen wir tagtäglich an diesen Figuren und Gemälden vorbei, und das ist in Ordnung so, sie dürfen von mir aus gerne an Ort und Stelle bleiben. Ich bin nicht der Meinung, dass diese Gemälde abgehängt und Skulpturen zerschlagen werden sollten. Bilderstürme haben sich selten produktiv ausgewirkt.
Aber ich will, dass mit dem Finger auf sie gezeigt wird, dass man sie anschreit und ihnen mitteilt, dass sie unvollständig sind. Ich will nicht, dass sie weiterhin ungestört ihre Geschichte erzählen können, dass man sie kommentarlos akzeptiert und dadurch ihre Geschichte einseitig weitertradiert wird. «All diese völlig im Dunkeln gelassenen Lebensläufe harren noch der Aufzeichnung», beklagt Virginia Woolf 1929 in A Room of One’s Own, «der Druck des Stummseins, die Anhäufung nie beschriebenen Lebens.» Wo sonst, wenn nicht an einer Universität sollen kanonische Setzungen kritisch reflektiert und diskutiert werden?
Stufen hochkriechen
Eine Intervention im Kollegiengebäude versucht das «nie beschriebene Leben» sichtbar zu machen. Die Treppe in der Eingangshalle nennt auf ihren einzelnen Stufen Jahrgang und Namen der ersten Frauen, die an der Universität Basel studiert haben. Wer für dieses Gegenmodell verantwortlich zeichnet, wird weder am Ort selber, noch in der Literatur geklärt. Die Stufen der Treppe ins erste Obergeschoss reichen bis ins Jahr 1908, die Treppe ins zweite Obergeschoss nennt keine Namen mehr. Ironischerweise schmücken die Namen auch weder Wände, noch nehmen sie Raum in Anspruch. Sie gliedern sich unauffällig in die bestehende Architektur. Man kann sich im Kollegiengebäude nicht fortbewegen, ohne über sie hinwegzugehen. Schritt um Schritt, hoffentlich in Richtung Fortschritt.
Zahlen
Um das Tempo dieses Fortschritts an der Universität Basel voranzutreiben, kümmert sich die Fachstelle Diversity. Eine Kernaufgabe der Fachstelle ist es, «Frauenanteile auf den höheren Qualifikationsstufen merklich zu steigern.» Im Jahr 2018 verzeichnete die Universität Basel unter den Professuren einen Frauen*anteil von nur 22% (wobei dies bei den unterschiedlichen Fakultäten stark variiert). Ein Prozent mehr als im Vorjahr, immerhin.
Wie macht man das eigentlich, wie erhöht man diesen Anteil? «Einerseits haben wir das erfolgreiche Karriereprogramm antelope, welches Nachwuchswissenschaftlerinnen auf dem Weg zur Professur unterstützt und auch Entlastungsinstrumente wie get on track & stay on track, die versuchen sicherzustellen, dass Frauen (und auch Männer) mit Familienpflichten in der Forschung bleiben und nicht aus der Universität austreten, sei das nach dem Master oder nach dem Doktorat», erklärt mir Nicole Kälin, Leiterin der Fachstelle Diversity. «Andererseits gibt es auch strukturellen Handlungsbedarf. Wir sagen immer: Es gibt schon qualifizierte Frauen und unsere Aufgabe ist es, diese zu finden und beispielsweise früh im Prozess eines Berufungsverfahrens durch aktive Rekrutierung direkt anzusprechen.»
Eine Studie aus dem Jahr 2010 vom Bundesamt für Statistik belegt, dass sich der Frauen*anteil an Schweizer Universitäten auf allen Qualifikationsstufen nur gemächlich nach oben bewegt. Wieso diese Trägheit, frage ich mich. «Das Bewusstsein ist vielerorts da, aber nicht überall gleichermassen», meint Nicole Kälin. Zudem dürfe man nicht vergessen, dass ein Berufungsverfahren ein «zentrales Geschäft einer Universität ist und jede Berufung im Prinzip einen Fachbereich für die nächsten 20 Jahre prägt.»
Mangelnde Vorbilder
Um zu bemerken, dass Frauen* an der Universität Basel unterrepräsentiert sind, muss ich aber eigentlich gar keine Statistiken lesen. Es reicht, mit offenen Augen durch das Kollegiengebäude zu laufen und Räume und Bilder auf sich wirken zu lassen. Denn das tun sie, genau wie die Sprache. Ob bewusst oder nicht, sie konstituieren unser Handeln und repräsentieren gesellschaftliche Werte. Was bedeutet es also für unser akademisches Umfeld, wenn ich in meinem Studium keine Texte von Frauen* zu lesen bekomme, selten von Professorinnen unterrichtet werde und weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft auf eine Vielzahl von Vorbildern blicken kann?
Ob auf der Literaturliste eines Seminars, im Kurrikulum einer Vorlesung, in Kunstwerken im öffentlichen oder institutionalisierten Raum: Ich will im Jahr 2019 nicht mehr hören, dass keine weibliche Position gefunden wurde, dass man den Kanon unkritisch übernimmt. Wir schreiben nicht mehr das Jahr 1929, denn seither wurden genügend Frauen* aus den dunklen Winkeln der Geschichte hervorgeholt, die gezeigt haben, dass Denken und Schaffen keine Fragen des Geschlechts sind. Und dennoch hat meine Kommilitonin vergeblich auf ihre Philosophin gewartet. Vorbilder sind wichtig, denn Meisterwerke sind «keine einzelnen und einsamen Geburten», sondern vielmehr «das Erzeugnis vieler Jahre gemeinsamen Denkens», um in Virginia Woolfs Worten zu sprechen.
Frauen*streik
Ich werde heute streiken, um auf Leerstellen hinzuweisen. Es gibt tausend andere Gründe, wofür am heutigen Tag eingestanden wird und diese Sichtbarmachung ist meines Erachtens das grösste Verdienst des Streiks. Sexualisierte Gewalt, Lohnungleichheit, eine geschlechtergerechte Sprache und die Bekämpfung von Diskriminierung sind Themen, die endlich auf die politische Agenda geschrieben werden sollten, für Ausreden ist es zu spät.
Während ich diese Sätze tippe, sehe ich vor meinem inneren Auge, wie empörte Menschen ihre Kommentare auf die Tastatur hämmern, deshalb möchte ich mit den Worten Virginia Woolfs schliessen, die bereits 1929 wusste, dass jede Frage zum Thema Geschlecht höchst umstritten ist und «dass man nicht hoffen [kann], die Wahrheit zu sagen. Man kann nur zeigen, wie man zu seiner Meinung gelangt ist.»






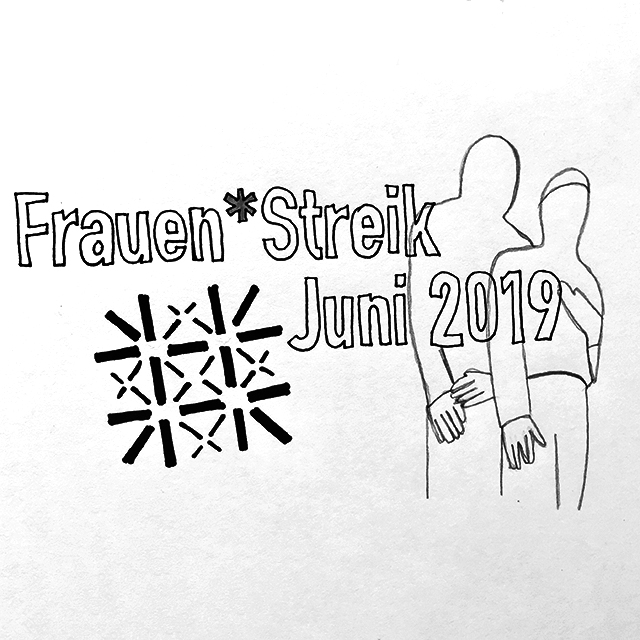





3 Kommentare
Fr, 14. Juni 2019 / 15:20 Uhr
Sehr scharfsinnig! Danke für den inspirierenden Text!!!!
Mo, 17. Juni 2019 / 17:12 Uhr
Ja, der Text hat mir auch ausserordentlich gut gefallen. Sehr schön geschrieben und gut recherchiert. Und dass Sie sich als „nur halb so schnell wie ihre Mitmenschen“ beschreiben, scheint in diesem Falle wohl besser! Denn so können Sie viel bessere Texte schreiben :) Weiter so.
Fr, 28. Juni 2019 / 09:48 Uhr
Sehr anschaulich auf den Punkt gebracht, merci!