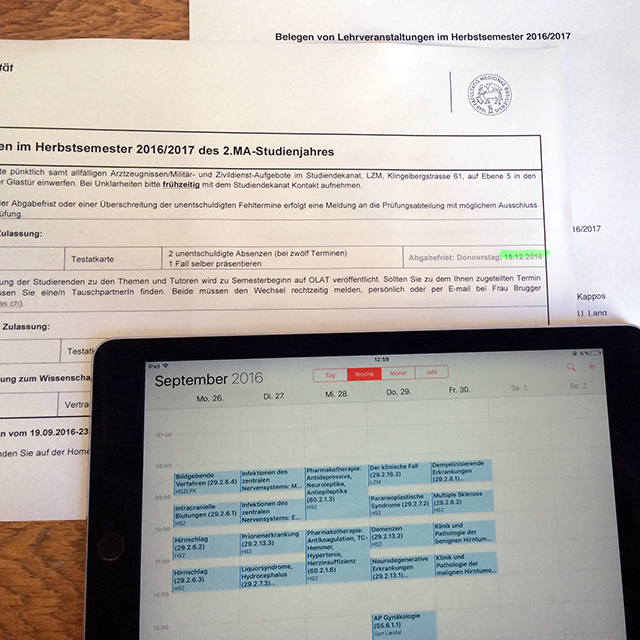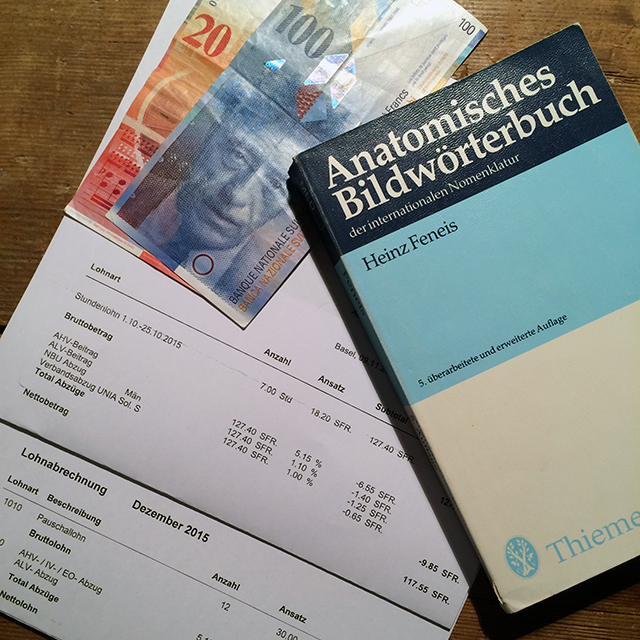Biel: Nimmt man den Bus zum Spital, ist die Route von selbstgebastelten «Merci»-Schildern gesäumt. Die Menschen bedanken sich bei allen, die sich für die Gesundheit anderer einsetzen. Die Regierung hat eine lange Liste von Massnahmen beschlossen, um das Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen. Ausserdem wurde das Militär eingezogen und freiwillige Medizinstudierende zur Unterstützung in den Spitälern gesucht. Ich habe mit einigen Kommilitoninnen und Kommilitonen aus der Medizin gesprochen, die momentan im Einsatz sind:
April. Das ist der Monat, in dem die Basler Medizinstudierenden in ihr Wahlstudienjahr geschickt werden. Das bedeutet, dass sie zehn Monate lang in verschiedenen Spitälern und in unterschiedlichen Fachrichtungen den Medizineralltag kennenlernen. Die Basler sind zu dieser Zeit normalerweise überall: von Europa bis Afrika. Doch alle Auslandsaufenthalte wurden aufgrund des Coronavirus abgesagt, sogar Stellen in der Schweiz wurden gekündigt – da sie keine Arbeit haben. Elektive Eingriffe wurden gestrichen, in vielen Kliniken herrscht nur noch der Notfallbetrieb und auch Spitäler melden Kurzarbeit an. Und doch brauchen die in der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie geforderten Spitäler nun eine andere Art von Unterstützung: Sie suchen Studierende, um Abstriche zu machen oder um die Intensivstationen zu entlasten. Von einem normalen Spitalbetrieb kann nicht die Rede sein.
Pneumologie St. Gallen, Covid-19-Station
Die allererste Stelle im Spital und er befindet sich ausgerechnet auf der Covid-19-Station: Pavel, Medizinstudent im 10 Semester, blutjunger UHU (Unterassistent). «Die Stimmung ist komisch. Ich würde nicht sagen, dass die Ärzte nervös sind, es herrscht einfach eine grosse Unsicherheit. Man weiss einfach nicht, was einen am nächsten Tag erwartet», erzählt er mir am Telefon – Social Distancing natürlich.
Letzte Woche wurde die Hälfte der Betten auf der Station mit Absicht leer gehalten, um einen plötzlichen Anstieg der pflegebedürftig Erkrankten abfangen zu können. Ein Viertel der Zimmer ist mit Covid-19-Patienten gefüllt und der Rest wird für Menschen mit akuter Verschlechterung einer chronischen Lungenerkrankung wie Asthma genutzt. Man kann sich ja schliesslich nicht aussuchen, wann man krank wird.
«Wir haben ein klares Schema für die Behandlung der Covid-19-Patienten und arbeiten auch viel mit der Intensivstation zusammen, um die Betroffenen rechtzeitig dorthin verlegen zu können», verrät mir Pavel weiter. Vor zwei Tagen sei sogar nur ein Viertel der ganzen Station belegt gewesen. Nach dem anfänglichen Schock auf der Covid-19-Station arbeiten zu müssen, hört sich Pavel ziemlich ruhig und selbstsicher an. Man nimmt eben einen Tag nach dem anderen.
Predigerkirche, die neue Aussenstelle des Universitätsspitals Basel
Wo gewöhnlich Gebete gesprochen und Orgeltöne erklingen, werden jetzt Covid-19-Abstriche gemacht. Medizinstudierende melden sich freiwillig für die Arbeit im neuen Zentrum der Abstriche. Nur ist die Nachfrage grösser als das Angebot: Nicht alle Studierenden können sich nützlich machen.
Andrea, Medizinstudentin im 12. Semester, war da: «Ich bin überrascht, dass nicht mehr Menschen hier auftauchen, um sich testen zu lassen. Es gibt zwar immer etwas zu tun in der Predigerkirche, trotzdem hätte ich einen deutlich grösseren Ansturm erwartet.»
Den Patienten werden Fragen gestellt, oft auch Fieber, Blutdruck und Puls, etc. gemessen und je nach Zustand können sie wieder nach Hause gehen. Nach circa drei Tagen bekommen sie das Abstrich-Resultat zugeschickt oder werden telefonisch informiert. Diejenigen, die keinen guten Allgemeinzustand aufweisen, zum Beispiel weil sie zu wenig Sauerstoff im Blut aufweisen, werden auf den Notfall des Unispitals gebracht. «Die Menschen sind alle nervös, wenn sie hierher kommen. Das merkt man auch am hohen Puls. Sie haben Angst.»
Im Grossen und Ganzen habe die Arbeit in der Predigerkirche Andrea aber beruhigt. Denn der Grossteil der Menschen, die sich testen lassen, ist in einem ziemlich guten Gesundheitszustand. Absolut nicht vergleichbar mit den Bildern von Patienten in Bauchlage, die auf den Intensivstationen ums Überleben kämpfen.
Bruderholz, Sanitätsdienst des Militärs
«Man gewöhnt sich allmählich an das konstante Piepsen», erklärt Jonas*, Studierender der Zahnmedizin, 6. Semester. Vor drei Wochen musste er in das Militär einrücken. Nach einer kurzen Weiterbildung wurde er nun im Bruderholz-Spital auf der Intensivstation stationiert. Während dieser Zeit konnte er kein einziges Mal nach Hause, lebt in der Kaserne und im Spital.
«Die Intensivpfleger hier haben viel zu tun, da durften wir auch ein wenig mithelfen. Dann kommt es schon einmal vor, dass man vier Stunden am Stück beim selben Patient bleibt und durcharbeitet. Dabei steht man wie unter Strom, merkt gar nicht, wie erschöpft der Körper ist, bis man sich nach getaner Arbeit endlich hinsetzten kann. Die Arbeit der Intensivpfleger ist brutal hart, die verdienen meinen allergrössten Respekt!»
Seit ein paar Tagen ist er nun neu zum Materialauffüllen eingeteilt. In anderen Worten, er schlägt die Zeit tot. «Wir sind momentan zu viel Personal für die Anzahl Patienten hier im Bruderholz.» Von den zwölf Stockwerken des Spitals werden gerade einmal drei genutzt, der Rest steht leer. Sogar die Intensivstation ist nur zu einem Drittel gefüllt. «Man wartet immer noch auf den grossen Ansturm», meint er und erklärt, dass die Patienten ungefähr 25 Tage nach Ansteckung bei ihnen auf der Intensivstation landen. Man hinke den aktuellen Zahlen folglich ein wenig hinterher. Die Ruhe vor einem möglichen Sturm?
Pathologie, Liestal
«Auf der Pathologie ist einiges los!», berichtet Jana*, Medizinstudentin im 10. Semester, ebenfalls frischer UHU: «Normalerweise gibt es 1-2 Autopsien im Monat, nun hatten wir in drei Tagen bereits vier!» Pathologen versuchen zu verstehen, was der Virus im Körper genau macht. Die Forschung läuft auf Hochtouren, Ferien werden gestrichen. Es gibt schlicht und einfach zu viel zu tun.
Das medizinische Oxymoron
Die ganze Situation in den Spitälern ist paradox. Alle, die auf den Intensivstationen schuften und krampfen, leisten eine unglaubliche Arbeit. Ehemalige Intensivmediziner werden rekrutiert, um diese zu unterstützen. Medizinstudierende mit Anästhesieerfahrung werden von Spitälern präventiv in die Arbeit des IMC (Intermediate Care) eingeführt, damit die Anästhesisten bei Bedarf auf den Intensivstationen eingesetzt werden können… Und der Rest?
Alle anderen Fachrichtungen haben kaum etwas zu tun. Medizinisches Personal macht Minusstunden. Material wird überall eingespart. Hebammen in Ausbildung dürfen nicht mehr bei Geburten dabei sein, aus Angst davor, man könne das Kind mit dem Virus infizieren. Das Gesundheitssystem befindet sich in Narkose. Nur das Überlebensnotwendige wird aufrecht erhalten.
Mein Eindruck nach den vielen Gesprächen ist, dass es zumindest in den Einrichtungen, in denen meine Mitstudierenden im Einsatz sind, noch weitere Kapazitäten im Gesundheitswesen gibt, um eine grössere Viruswelle zu überstehen.
Natürlich fehlt es gerade Medizinstudierenden noch an Erfahrung und Fachwissen, aber nicht an Motivation! Was die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Wenn man aber um ein, zwei Ecken denken kann und bereit ist, unkonventionelle Wege zu gehen, gibt es viele, die bereit sind, zu helfen.
* Die markierten Namen wurden auf Wunsch der Gesprächspartner geändert.