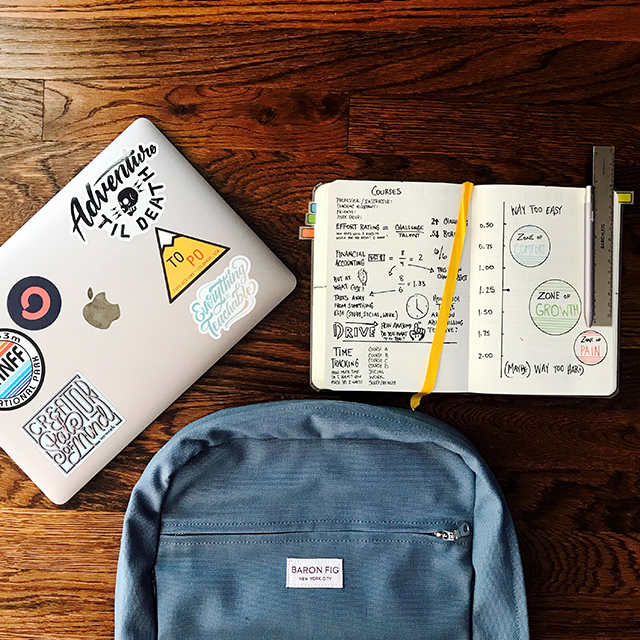Der Bedarf an Nachhilfe scheint ungebrochen hoch zu sein. Die Pandemie hat nicht nur bei den sozialen Kontakten Lücken gerissen, sondern diese teilweise auch im Schulstoff hinterlassen. Um die Frage zu beantworten, wie und warum man gerade als Student*in von der Nachfrage profitiert, habe ich meine eigene Nebentätigkeit als Nachhilfelehrer unter die Lupe genommen.
Viel verpasst und wenig gelernt – so oder so ähnlich liesse sich der Einfluss der letzten zwei Jahre auf die Schulbildung zusammenfassen. Ob diese Einschätzung der Wahrheit entspricht, sei dahingestellt, was bleibt ist der Hilferuf vieler Betroffener. Daher das Grundlegende zuerst: Was hat es mit dem zweitbeliebtesten Studierenden-Job (nach der Tätigkeit als Velokurier*in) auf sich? Weshalb ist die Nachhilfe heute noch so gefragt? Woran fehlt es den Schüler*innen?
Die Spannweite von Antworten auf diese Frage ist sehr gross und das sieht man schnell anhand kleiner Beispiele: Manche Kinder werden nicht genug gefördert, da ihre Eltern viel arbeiten. Andere haben Schwierigkeiten, sich in grossen Klassen zurechtzufinden und wieder andere lernen langsamer und benötigen mehr Zeit für den selben Stoff, oder lernen schneller und die fehlende Herausforderung führt zu Langeweile.
Ebenso ist der Anspruch auf die Jugend im modernen Zeitgeist beinahe ein Affront an das Individuum: Man solle möglichst schnell und ohne Umwege erfolgreich sein, sich aber gleichermassen mit grösstmöglicher Flexibilität an die globalisierte Welt anpassen.
Auch die Art und Weise der Wissensvermittlung befindet sich im Wandel und das leider nicht immer zum Guten hin: Die Stoffmenge wird dichter und gleichzeitig sinkt die Zeit der sinnvollen Bearbeitung. Starre Grenzen zwischen verschiedener Schulstufen werden aufgeweicht. Dies mag zwar eine positive Entwicklung darstellen, jedoch wird so auch der Kenntnisstand von Schüler*innen in Klassen dadurch diverser. Das sinkende Leistungsniveau muss dann mühselig von Lehrpersonen aufgefangen werden und dazu kommt noch die kafkaesk anmutende Bürokratisierung der Schule.
«Bildungslücken» sind also ein Produkt vieler kleiner Bestandteile. Wie hole ich jetzt als Nachhilfelehrer ganz verschiedene Menschen in einem starren Bildungssystem ab? Wie finde ich eine Schablone, die auf alle passt?
Persönlich abgestimmter Einzelunterricht als (scheinbarer) Heilsbringer
Ich habe bisher insbesondere Physik und Mathematik als Nachhilfetutor unterrichtet. Über alle Schulstufen und Jahrgängen hinweg – von (potenziell) sehr guten bis hin zu eher ungenügenden Schüler*innen – sind mir oft die selben Schwierigkeiten aufgefallen: Schüler*innen bremsen sich psychologisch aus, «Ich bin einfach schlecht in Mathe» (leider betrifft das nach eigener Erfahrung weiterhin eher Frauen), oder denken, dass «neue Thema» sei zu abstrakt.
Ich bin der starken Überzeugung, dass ausnahmslos alle in der Lage sind, weit mehr zu verstehen als der eigene Selbstwert es zulässt. Den Schüler*innen hier Mut zu machen ist nicht nur hilfreich, sondern auch ehrlich. Darüber hinaus lag es oft «nur» an Banalitäten: Bruchrechnen und Algebra («Gleichungen umstellen»). Ich kann diesen Punkt nicht oft genug unterstreichen, denn meist ist das der Knackpunkt aller Probleme und dieser lässt sich vollständig beheben.
Das erzeugt in mir eine sehr ernüchternde Erfahrung: Ein*e Schüler*in sucht Kontakt und möchte die «Ableitung» einer Funktion verstehen, also fange ich an die grundlegenden Ideen zu erklären, bis man zusammen Übungen durchrechnen kann. Achtet man dann auf den Subtext von harmlosen Fragen wie «Wie bist du von Zeile 2 auf Zeile 3 gekommen?», merkt man schnell, dass die Frage eigentlich eine ganz andere ist: «Wie stelle ich diesen Bruch um, um den neuen Ausdruck zu erhalten?». In diesem Moment muss ich oft erst einmal tief durchatmen und erwidere: «Kennst du die Regel?»
Sobald man die Handvoll Regeln nach und nach durchspielt und übt, sehe ich oft dieses «Leuchten» in den Augen. Ein ganz besonderer Moment, bei dem auf einmal Konzepte zusammen kommen und Menschen anfangen, Altlasten abzuwerfen und die Nebelwand komplett verpufft. Auf einmal haben selbst Schüler*innen mit ungenügenden Noten Spass am Stoff. Wenn Menschen den Hammer endlich benutzen können, ist zwar alles erstmal ein Nagel, aber es kann so schön sein zu hämmern.
Für mich ist das nicht nur eine didaktische Übung, es ist auch ein Test meines Wissens. Klar kann man sich in einer mündlichen Prüfungen mit Fachwörtern bewaffnen und so im verbalen Boxkampf mit Professor*innen mithalten, ob ich es als Student*in dann wirklich verstanden habe, ist dann noch nicht in Stein gemeisselt.
Im Gespräch mit Schüler*innen und (jüngeren) Studierenden baut sich ein neuer Kontext auf, man schärft das eigene Wissen, lernt es vermitteln und auch auf neue Bereiche abstrahieren zu können. Dabei erlangt man nicht nur mehr «Soft Skills» (um ein Unwort der Neuzeit zu benutzen), sondern schliesst die eigenen Bildungslücken. Denn, eine reine Tatsachensammlung ist noch keine Bildung, Gedanken und Ideen über die Welt sind nicht statisch, sondern entwickeln sich in einem Spiel aus persönlicher Erfahrung, dem Zeitgeist und einigen «Gewissheiten» dynamisch weiter. Oder um es plakativer zu sagen:
«Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat.»
– Werner Heisenberg