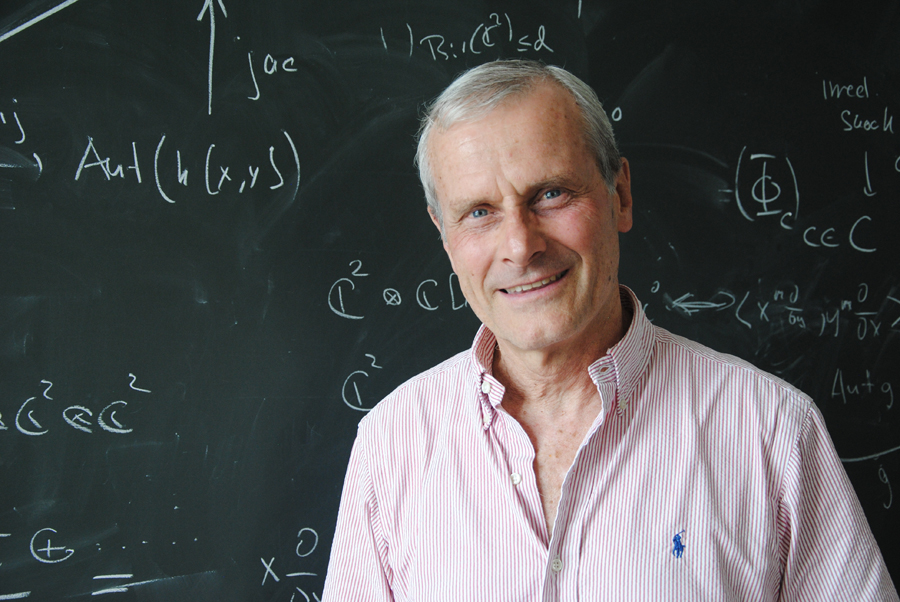Als Hanspeter Kraft seine Mathematikprofessur an der Universität Basel antrat, war der Eiserne Vorhang noch lange nicht gefallen, Tschernobyl düstere Science Fiction und IBM brachte gerade den ersten PC heraus. 33 Jahre später ist Herr Kraft Basels dienstältester Professor und damit die perfekte Auskunftsperson, um herauszufinden, wie sich unsere Universität in den letzten Jahrzehnten verändert hat.
Herr Kraft, wenn Sie die Studierenden von heute mit denen aus Ihrer Anfangszeit vergleichen: Welche Unterschiede stellen Sie fest?
Etwas hat sich sehr zum Positiven geändert: Wir haben viel mehr Frauen als am Anfang. Und diese Frauen sind exzellent. Denn abstraktes Denken hat nichts mit Mann und Frau zu tun. Männer und Frauen sind gleich gut.
Was fällt Ihnen sonst noch auf?
Die Studierenden von heute sind ein bisschen angepasster. Ich habe immer gesagt „Himmeldonnerwetter, jetzt geht doch endlich mal auf die Barrikaden. Protestiert. Macht diese Uni zu.“ Aber da war nichts zu machen. Ich vermisse Studierende, die sagen, was ihnen nicht passt. Nachdem Bologna eingeführt wurde, habe ich nach kurzer Zeit gefragt: „Gefällt Ihnen das eigentlich? Jetzt gibt es ständig Prüfungen. Wir sind im Winter Skifahren gegangen, wenn es Schnee gab, und haben auch sonst öfters geschwänzt. Und jetzt müssen Sie hier sitzen und Klausuren schreiben.“ Wir stellten am Institut fest, dass die Studierenden entweder in der Vorlesung sitzen oder für Prüfungen lernen. Das kann es ja nicht sein. Irgendwann muss man auch einmal Freizeit haben und über die Sachen nachdenken, auf die man Lust hat. Seit Bologna haben die Studierenden viel weniger Zeit neben der Uni. Aber Bologna ist vermutlich die einzige Variante, mit diesen Massen zurechtzukommen. Es war eben eine Fehlentscheidung, zehnmal so viele Studierende an den Unis haben zu wollen. Tausend Leute in einer Vorlesung! Das kann nicht gut gehen, da geht zu viel verloren. Man sollte doch zusammen arbeiten können, Gedanken austauschen und auch direkten Kontakt zu den Assistierenden und den Professorinnen und Professoren haben. Das ist das, was ich mir wünsche.
Was halten Sie von technischen Veränderungen an der Uni?
Ich bin ein Technologiefan, und mein iPad habe ich stets griffbereit. Ich sage immer: „Meine Damen und Herren, Computer sind dazu da, dass man eine Tätigkeit nur einmal machen muss.“ Das ist sehr positiv! Ich denke schon, dass ein paar Sachen durch die Elektronik anders geworden sind. Nicht negativer, aber anders. Man muss aber auch sehen, dass die Wandtafel beispielsweise riesige Vorteile gegenüber PowerPoint hat. Erstens müssen Sie sie regelmässig putzen, da können die Studierenden wieder durchatmen. Zweitens entwickeln Sie an der Tafel etwas. PowerPoint ist nicht parat dafür, aufs Publikum zu reagieren. Aber für andere Zwecke ist PowerPoint die Lösung. Bei Fächern, in denen relativ viel Wissen vermittelt wird, muss man Bilder sehen und das kann man genial mit PowerPoint lösen. Ich glaube, diese Wissenschaften haben enorm davon profitiert. Früher hat man einfach Bilder am Overheadprojektor gezeigt und alles dunkel gemacht. Dann sind die Leute eingeschlafen. Das ist heute nicht mehr so.
Vor ein paar Tagen haben Sie Ihre letzte Vorlesung an der Universität Basel gehalten. Wie lautet Ihr persönliches Fazit zu Ihrer Basler Zeit?
Ich komme ja ursprünglich aus Basel und bin dann nach meiner Promotion weggegangen, erst nach Bonn, später war ich in Hamburg. Als ich vor 35 Jahren einen Anruf aus Basel bekam und gefragt wurde, ob ich nicht zurückkehren möchte, sagte ich spontan nein. Doch meine Familie überzeugte mich, doch nach Basel zu gehen und ich habe es nicht bereut. Was mir immer schon gefallen hat, ist die Kleinheit der Universität! Ich sehe aber die Gefahr, dass das verloren geht und das universitäre Leben anonymer wird. Ich habe die persönlichen Beziehungen zu meinen Kolleginnen und Kollegen und zu den Studierenden stets sehr geschätzt. Alles in allem habe ich sehr positive Sachen hier erlebt. Nur einmal habe ich überlegt zu gehen. Denn da sollte das mathematische Institut stark verkleinert werden. Dies war dann aber zum Glück nicht der Fall. Und so habe ich meine Zeit hier sehr genossen.